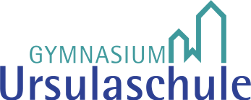Ein Vortrag zum Nahostkonflikt
Am 13.05.2025 hatten die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs die Gelegenheit, ihr Verständnis des Nahostkonflikts zu vertiefen.
Seit 19 Monaten herrscht ein Krieg insbes. zwischen Israel und der Hamas. Im Gazastreifen leben die Menschen derzeit unter den unmenschlichen Bedingungen von Krieg, Zerstörung und Hunger. Der Krieg hat viele Tote und Verletzte, besonders auf Seiten der palästinensichen Zivilbevölkerung gefordert: die Gesundheitsbehörde des Gazastreifens gibt über 50.000 Tote an, die UN halten die Zahlen für glaubwürdig.
Auslöser des Krieges war am 7. Oktober 2023 der Überfall der Hamas auf israelische Festivalbesucher, Soldaten und Kibbuzangehörige, den eine große Brutalität kennzeichnete. Mit ca. 1200 Toten und ca. 250 Geiseln war dieses Ereignis für viele Isrealis traumatisch und hat auch unseren Gesprächspartner sehr geprägt.
Der viele Jahre in der Begegnungsarbeit zwischen jüdischen und palästinensischen sowie jüdischen, christlichen und muslimischen Jugendlichen tätige Israeli Amos Davidowitz hielt einen Vortrag zum Gazakrieg und stand für Fragen zur Verfügung. Amos Davidowitz engagiert sich seit langem für das friedliche Miteinander und Demokratie, ist aber zugleich Angehöriger der Armee. Wie alle Israelis (außer den Ultra-Orthodoxen) hat er seinen Wehrdienst abgeleistet, er hat in mehreren Kriegen aktiv gekämpft und berät derzeit insbes. junge Soldaten bei ihrem Einsatz im Gazakrieg und im Grenzgebiet zum Libanon. Bereits vor dem Krieg war als Deeskalationstrainer für Grenzsoldaten im Einsatz.
Der von den Schülerinnen und Schülern empfundene Widerspruch, als Soldat für den Frieden einzutreten, ist für ihn keiner – anders als Deutschland sei Israel permanent in einer Bedrohungslage: Mehrere arabische Nachbarstaaten sprächen dem Land das Existenzrecht ab und bekämpften es aktiv, mit der Hamas und der Hisbollah verübten nicht legitimierte Organisationen immer wieder Raketenangriffe und Terroranschläge.
Gerade nach dem brutalen Angriff der Hamas sei es sein Ziel, sein eigenes Überleben zu sichern und seine Familie sowie den Staat insgesamt zu schützen.
Im Lauf des Vortrages und Gespräches wird diese persönliche Betroffenheit immer wieder deutlich. Und auch das Selbstverständnis und die Dilemma-Situation, vor die sich die israelische Bevölkerung gestellt sieht, durchziehen seinen Vortrag: zum einen ist der Staat Zufluchtsort für die (Nachkommen der) Überlebenden von Verfolgung und Holocaust, zum anderen ist der politische Konflikt mit den Palästinensern ungelöst und führt zu asymmetrischer Gewaltausübung. Die moderne Armee Israels könne nur mit hohen sogenannten Kollateralschäden gegen die Hamas vorgehen – ein Beispiel ist das Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen und deren Taktik, Zivilisten als „Schutzschilde“ zu funktionalisieren.
Die Wahrnehmung dieser Situation als Dilemma, das eben zu Verlusten führe, darf allerdings nicht vergessen machen, dass es hier auch um unbeteiligte Menschenleben geht. Für Amos Davidowitz bleibt die Frage offen, wie die Bevölkerung in Gaza mit Lebensmitteln versorgt werden kann, ohne dass diese in die Hände der Hamas geraten oder inwiefern dieser Krieg innenpolitischen Zielen Netanjahus dient.
Insgesamt ist der Vortrag von einer – für Zeitzeugengespräche nicht unüblichen – Vermengung vom Bemühen um Fakten und Erklärungen einerseits und persönlicher Betroffenheit und subjektiver Perspektive andererseits geprägt. Für das Publikum bleiben Fragen offen, aber zugleich werden die Komplexität des Nahostkonfliktes im Allgemeinen und des Gazakrieges im Besonderen sowie der Blick Israels auf den Konflikt klarer.
In den nächsten Wochen soll eine Veranstaltung zur palästinensichen Perspektive folgen. Mit beiden Veranstaltungen geht es der Ursulaschule darum, das Verständnis und die Auseinandersetzung mit dem Konflikt, der letztlich politisch zu lösen sein wird, zu vertiefen; wir leben in einer hochkomplexen medialen Gegenwart, die der differenzierten Auseinandersetzung bedarf. Es sollte dabei nicht darum gehen, für die eine oder andere Seite Stimmung zu machen, sondern immer darum, das persönliche Leid wahrzunehmen und zu achten, Verständnis zu entwickeln und für Verständigung und Frieden einzutreten – nur wer die Postionen und gerade auch die ihnen zugrundeliegenden Narrative und Haltungen kennt, kann zu einem konstruktiven Umgang beitragen.
In diesem Sinne war diese Veranstaltung bereichernd und stellt einen sehr lebensnahen Input für den Unterricht dar; sie fordert uns auf, genauer, differenzierter und tiefer auf die Nachrichtenlage zu schauen und ins Gespräch zu kommen.
Text: E. Bodensieck